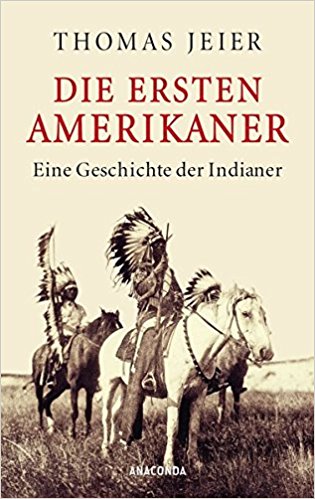 „Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“
„Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“
Dies Buch ist ein kniffliger Fall. Sein Verfasser ist ein durchaus renommierter Autor, in dessen (sehr langer) Werkliste jedoch auch zahlreiche Groschen- und Abenteuerromane auftauchen. Natürlich sehe ich dieses Sachbuch nicht allein deswegen kritisch und solange ich keinen seiner Romane – von denen einige auch im historischen und gegenwärtigen Milieu der amerikanischen Ureinwohner spielen – gelesen habe, werde ich sie nicht vorverurteilen. Aber sowohl das, was in den Klappentexten dieser Romane steht (das klingt schon hier und da sehr nach heischendem Kitsch), als auch einige Bemerkungen in „Die ersten Amerikaner“, haben mich etwas stutzig gemacht.
Es gibt da zum Beispiel dann und wann Widersprüche in den Aussagen. Ein Beispiel: Zuerst weist der Autor die Marterpfähle als regionale Eigenheiten einer bestimmten Stammeskultur aus, einige Seiten später spricht er dann aber davon, dass jede/r weiße Siedelnde im mittleren Westen am Marterpfahl landen konnte, wenn die Ureinwohner*innen seine Farm überfielen.
Auch schwankt immer wieder das Ausmaß der Darstellung: manchmal spricht Jeier klug und kundig über die verschiedenen Stämme, bevor er sich dann in anderen Abschnitten in bestimmte Beispiele hineinsteigert, den Leser*innen einen beispielhaften, schmalen Eindruck von bestimmten Phänomenen gibt. Gegen diese Sprunghaftigkeit, den Wechsel zwischen Weitläufigkeit und Konkretion, ist eigentlich nichts einzuwenden, das Ganze wirkt aber hier und da ein wenig unübersichtlich und führt außerdem dazu, dass manche Abschnitte extrem informativ und spannend, andere voller Wiederholungen und ermüdender Kleinstdarstellungen sind. Beides zu haben ist sicher gut, aber es macht das Buch etwas unrund.
„Jedes Jahr halte ich mich mehrere Wochen oder Monate in den USA auf und verbringe einen großen Teil meiner Zeit im amerikanischen Westen und in Reservaten.“
Man kann festhalten: das Standardwerk zum Thema amerikanische Ureinwohner*innen hat Jeier mit diesem Buch nicht vorgelegt. Trotzdem kann er mit sehr viel Insiderwissen aufwarten und hat meist einen klaren Blick, der die native americans nicht verklärt oder als bloße Opfer stilisiert, sondern das an ihnen begangene (und in einzelnen Geschichten von ihnen begangene) Unrecht und die verheerende Geschichte ihrer Dezimierung durch die europäischen Kolonialmächte in vielen Einzelheiten und Facetten schildert.
„Der Krieg gegen die Indianer, von Regierung und Kirche gleichermaßen vorangetrieben, wurde zu einem Genozid gigantischen Ausmaßes, der durch grausame Massaker und Massentötungen gekennzeichnet war. Die Angaben der zwischen 1492 und 1900 getöteten Indianer schwanken zwischen zwei und zehn Millionen Menschen. Die Ermordung von unbewaffneten und hilflosen Männern, Frauen und Kindern und die systematische Ausrottung ganzer Dörfer durch heimtückische Überfälle und der Ausbruch ansteckender Krankheiten gehörten zum Alltag der 300 Jahre dauernden Indianerkriege.“
„Die ersten Amerikaner“ ist vor allem ein Buch, das mitunter gekonnt den Spagat zwischen populärwissenschaftlicher Darstellung und tiefergehenden Ambitionen meistert, manchmal bei diesem Spagat aber auch etwas ungeschickt aussieht. Es werden sehr viele Geschichten erzählt und Wissen wird hier und da großzügig gestreut. Einige Abschnitte haben es mir sehr angetan, wie etwa die Schilderungen der von den mittelamerikanischen Einflüssen geprägten Hochkulturen im Süden der heutigen USA und einige Schilderungen zur heutigen Lage der natives sind Meisterstücke.
Dennoch kommt sich das Buch mit seiner akribischen Verbrechensverfolgung und -auflistung ein wenig selbst in die Quere. Gewiss, diese seitenlangen Nacherzählungen von konkreten Verbrechen sind wichtig und erfüllen die dokumentarische Ambition. Die Schilderung von Lebensweisen, Vorstellungen und dergleichen, die die Ureinwohner Amerikas pflegten, wird dabei auch nicht vergessen, sondern gewissenhaft und regelmäßig eingeflochten. Aber letztlich konkurrieren beide Aspekte ein wenig miteinander und die Darstellungen des Lebens fallen in meiner Leseerfahrung hinter die Darstellung des Sterbens und Unterdrücktseins zurück.
Das ist vielleicht folgerichtig, immerhin ist genau das mit den Ureinwohnern Amerikas passiert: ihre Kultur, ihre Lebensgewohnheiten und, in vielen Fällen, ihre Existenz, wurden ausgelöscht, es blieb ihre blutrünstige Statist*innenrolle in Westernfilmen. Vielleicht muss ein Buch diesem Narrativ, so zwingend es zu sein scheint und so gut es auch das Schicksal der natives widergibt, nicht folgen. Denn es ist ja nicht ihre ganze Geschichte (und Jeier schildert auch die Zeit vor der Begegnung mit Europa, aber eben nur in 2. Kapiteln).
Letztlich ist Jeiers Buch immer noch eine beeindruckende Arbeit, sicherlich die Arbeit vieler Jahre, die ich weder ihm noch allen potenziellen Leser*innen madig machen will. Meine Bedenken habe ich vorgebracht, jetzt bleibt nur noch, hervorzuheben, dass ich einige spannende Erkenntnisse und manch prägenden Eindruck aus diesem Buch erhalten habe. Es ist in jedem Fall ein lesenswertes Werk und vielleicht verfehlen meine Kritikpunkte letztlich auch die Idee dieses Buches, lassen sie außer Acht. Ich hätte mir wohl eine Geschichte der amerikanischen Ur-Einwohner gewünscht, in der nicht der Hauptaspekt auf den Verbrechen liegt, die sie erlitten (nicht um das Auszublenden, sondern weil ich mich für ihre Kultur und nicht primär für deren Untergang interessiere). Aber vielleicht ist das einfach nicht möglich. Vielleicht ist das die schlimmste Erkenntnis.