“Wenn ein Mensch im Traum das Paradies durchwanderte, und man gäbe ihm eine Blume als Beweis, dass er dort war, und er fände beim Aufwachen diese Blume in seiner Hand – was dann?”
Samuel Taylor Coleridge
“Zwei Tendenzen”, schrieb Borges im Epilog, “habe ich beim Korrigieren der Druckfahnen in den vermischten Arbeiten dieses Bandes entdeckt.
Zum einen die Tendenz, religiöse und philosophische Ideen wegen ihres ästhetischen Wertes und dessentwegen zu schätzen, was in ihnen an Einzigartigem und Wunderbarem enthalten ist. Zum anderen die Tendenz, anzunehmen (und mich dessen zu vergewissern), dass die Zahl der Fabeln oder der Metaphern, die zu erfinden die Vorstellungskraft der Menschen fähig ist, begrenzt sei, dass aber die zählbaren Erfindungen jedem alles bedeuten können, wie der Apostel Paulus.”
Jorge Luis Borges gehörte zu den seltenen Literaten, die ihr Leben nicht nur dem Schreiben, sondern vor allem dem Lesen gewidmet haben – Faszination war ihm alles und Bescheidenscheit sein höchstes Prinzip in Bezug auf seine eigenen Leistungen – welche allerdings ein paar der wichtigsten Impulse für die Moderne und Postmoderne lieferten, gar nicht zu reden von der Synthese aus Wissen, Philosophie und Phantasie, die seine Texte zu einer zeitlosen, inspirierenden Erfahrung machen. Kaum einer, der seine Erzählungen (Das Aleph, Fiktionen), seine Gedichte (Mond gegenüber; Schatten und Tiger) oder eben seine Essays liest, wird darin nicht einer der schönsten Ausformungen von gesetzter und doch dabei von wundersamen Eingebungen und Ideen angefühlter Erzählkunst und Gelehrtheit begegnen.
Seine zahllosen Lektüren und Interessen erstreckten sich auf nahezu alle Gebiete, von Religion über klassische Literatur, Krimis und phantastischen Erzählungen, nahöstliche, antike und moderne Philosophien, bis hin zu politischen Werken und historischen Momenten, altenglischer Literatur und Sprache und modernen Innovationen wie die von Joyce, Pound oder Valery. Für Borges war der Wert einer Idee wichtig und nicht ob sie sich in irgendeiner Weise instrumentalisieren ließ; Ideen als Spiegel, in denen sich eine bestimmte Ungewissheit oder Gewissheit unseres Lebens mannigfaltig widerspiegelt.
“Die Musik, die Zustände des Glücks, die Mythologie, die von der Zeit gewirkten Gesichter, gewisse Dämmerungen und gewisse Orte wollen uns etwas sagen oder haben uns etwas gesagt, was wir nicht hätten verlieren dürfen, oder schicken sich an, uns etwas zu sagen; dieses Bevorstehen einer Offenbarung, zu der es nicht kommt, ist vielleicht der ästhetische Vorgang.”
In diesem Buch teilen sich die Literatur, die Philosophie und die Geschichte das Feld. Von einer Notiz zum 23. August 1944 (Befreiung von Paris) und einer daraus folgenden These über das Böse, über Literaten wie Kafka, Coleridge, Wilde, Valéry, Nathaniel Hawthrone (diesen Autor kann ich, dank Borges, nur jedem empfehlen!), bis zum etwas längeren Essays “Widerlegungen der Zeit”, in dem Borges eine persönliche Theorie der Einheitlichkeit der Zeit vorstellt, wird der Leser auf einem Fluß der reinen Faszination mitgetragen. Ich denke man kann beim ersten Mal noch nicht alles fassen, was Borges hier in meist nur 3-5 Seiten langen Texte anschneidet, sicher aber bin, dass jede Leser das Buch mit einer neuen Anregung verlässt und es bestimmt wieder zur Hand nimmt. Denn Borges kann man immer wieder lesen: um sich Dinge ins Gedächtnis zu rufen, um Zusammenhängen und Verbindungen auf die Spur zu kommen, um sich von einer bestimmten Idee zu eigenen Gedanken verführen zu lassen. Jeder, der sich gerne in Gedanken an alles Mögliche, Faszinierende, Metaphysische, Inspirierende verliert, findet in Borges Büchern eine Welt, die wir für ihn geschaffen scheint – eine Welt voller erstaunlicher Bewandtnisse, mit großen Vorkommen einzigartiger Geschichten und Reliquien.
Borges Schriften sind nicht nur eines der großen Geschenke der lateinamerikanischen Literatur, magischrealistisch, allerdings auf andere Weise, sondern auch ein Anstoß selbst zu denken, Gedanken nicht nur zu setzen, sondern sie auszuformen, ihren Inhalt nicht vorauszusetzen, auch mal wider dem bereits Gedachten und Angenommenen zu denken; es steckt viel europäische Gelehrsamkeit in Borges Büchern, aber auch ebenso viel argentinische Selbstbehauptung, eine Art die Dinge in ihrem Status als Wunder anzusehen, in Opposition gegen das allzu Gesicherte, Alltägliche. (Er selbst schrieb lakonisch über die Argentinier: “Der Europäer und der Nordamerikaner sind der Ansicht, dass ein Buch, das irgendeinen Preis erhält, gut sein muss; der Argentinier gibt die Möglichkeit zu, dass es vielleicht nicht schlecht ist, trotz des Preises.”)
“Im Laufe eines Lebens, das weniger dem Leben als dem Lesen gewidmet war, habe ich oft festgestellt, das literarische Absichten und Theorien nichts anderes sind als Reizmittel, und dass das abgeschlossene Werk sie meistens ignoriert und sogar widerlegt. Wenn in einem Autor etwas steckt, kann keine Absicht, mag sich noch so albern oder irrig, dem Werk einen Schaden unheilbarer Art zufügen.”
Borges lesen, dass ist Träumen, Denken und Lesen zugleich. (“Schopenhauer schrieb bereits, dass unser Leben und unser Träumen Blätter desselben Buches seien und dass sie in der richtigen Reihenfolge zu lesen, Leben bedeutet, in ihnen wahllos zu blättern aber Träumen sei.”)

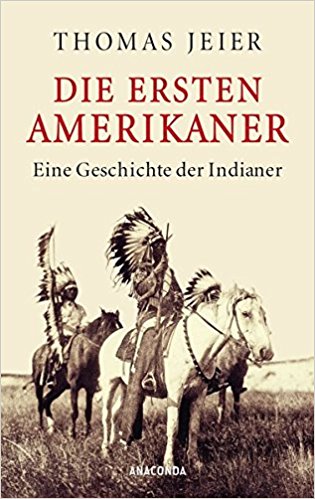 „Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“
„Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“ besprochen beim
besprochen beim