 Aus einem Land kommend, in dem das Wort „Nationalliteratur“ wohl noch lange, zurecht, einen sehr zweifelhaften Ruf haben wird, war ich gleichermaßen gespannt und skeptisch, als ich auf den ersten Seiten von Atwoods „Survival“ las, es war ihre Absicht in diesem Buch die spezifischen Felder und Kategorien der kanadischen Literatur herauszuarbeiten.
Aus einem Land kommend, in dem das Wort „Nationalliteratur“ wohl noch lange, zurecht, einen sehr zweifelhaften Ruf haben wird, war ich gleichermaßen gespannt und skeptisch, als ich auf den ersten Seiten von Atwoods „Survival“ las, es war ihre Absicht in diesem Buch die spezifischen Felder und Kategorien der kanadischen Literatur herauszuarbeiten.
Man muss vorwegnehmen, dass sich Atwood in ihrem Vorwort zunächst darauf verlegt, zu sagen, was „Survival“ nicht ist: keine Chronologie der kanadischen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, keine Geschichte der kanadischen Literatur anhand der Biographien der Autor*innen, keine umfassende Studie, kein Nachschlagewerk und auch Werten, also eine Art Kanon aufbauen, möchte die Autorin nicht. Ja, was ist denn dieses Buch dann, warum soll man es lesen, fragt man sich als Leser*in da und auch Atwood stellt (sich) diese Frage, nachdem sie all diese möglichen Erwartungen zurückgewiesen hat.
Und beantwortet sie gleich im Anschluss, wie oben bereits angedeutet: Das Buch soll eine Reihe von Grundstrukturen herausarbeiten, die die kanadische Literatur von allen anderen unterscheidbar macht. Kurzum, nachdem man dieses Buch gelesen hat, soll man ein Buch zur Hand nehmen und die ersten paar Seiten lesen und dann schon sagen können: das ist CanLit. Oder: das Buch konnte nur in Kanada geschrieben werden.
Um das zu erreichen hat Atwood ihr Buch in einige Kapitel unterteilt, die solche Grundstrukturen umreißen und die da heißen: „Überleben“, „Die Natur als Ungeheur“, „Tiere als Opfer“, „Ureinwohner“ und noch einige weitere. Jedem dieser Kapitel ist eine Doppelseite an Zitaten vorangestellt, dann folgt die jeweilige Auseinandersetzung.
Gleich warnen muss man wohl alle Leser*innen, dass Atwood eine Vorliebe für Lyrik hegt. Ich persönlich begrüße das, aber es wird sicher einige Leser*innen abschrecken. Mit Vorliebe meine ich nicht, dass sie nur oder mehrheitlich Lyrik zitiert, aber doch im größeren Maße als man es gewohnt ist und vor allem nicht in einem eigenen Kapitel, sondern kapitelübergreifend.
Auch ansonsten legt Atwood einige Eigenheiten an den Tag, manche sympathisch, manche etwas enervierend. So ist bspw. der Untertitel „Streifzug“ ernst zu nehmen, denn in der Tat bewegt sich Atwood schnell von einem Beispiel zum anderen und es geht ihr tatsächlich mehr um die Kategorien als um die Autor*innen und die einzelnen Werke. Wer sich daher sehr gezielte Lesetipps erhofft, wird vermutlich eher enttäuscht sein.
Schön ist dagegen, mit welch unprätentiöser Art Atwood durch die Literatur ihres Landes führt. Sie betont schon zu Anfang, dass es sein sehr persönlicher und auch nicht gerade neuer Einblick ist, den sie gewährt, aber dennoch hat man das Gefühl, sehr gut auseinandergesetzt zu bekommen, warum die Bücher und Texte, die Atwood ins Zentrum rückt, gut das nachbilden, was in der kanadischen Lebenswirklichkeit und Literatur dominant ist.
So muss man am Ende auch sagen, dass dieses Buch fast schon mehr über Kanada und seine Welten aussagt, als über seine Literatur (natürlich tut es das durch das Fernrohr der Literatur, aber der Ausblick ist eben das Thema, nicht die Beschaffenheit des Fernrohrs). Das ist natürlich nicht schlimm, solange man sich nichts anderes erwartet. Ich habe den Streifzug genossen, gerade weil er sich wenig mit literaturwissenschaftlichen oder stilistischen Punkten aufhält. Anderen wird es anderes gehen. Aber die sind hiermit gewarnt.
P.S.: Wichtig ist natürlich auch anzumerken: Das Buch erschien im Original 1972, also vor fast 50 Jahren.
 „Die Erde segelt dahin.
„Die Erde segelt dahin.




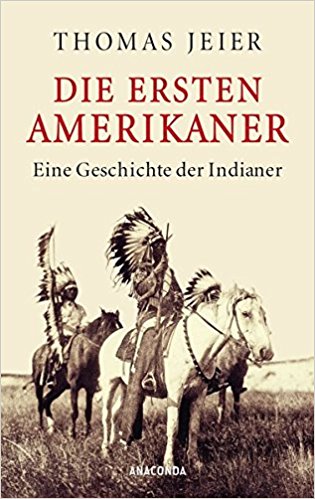 „Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“
„Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“