 “Noch während wir den Pfad entlangreiten, können wir sehen, wie übel Lige dran ist. Ein wunderschöner Bach, der wie ein endlos bereifter Bart verläuft. Feld um Feld besorgt aussehnenden Landes. Hohes geschwärztes Unkraut, und halb geerntete, verfaulende Nutzpflanzen. Dieses vergilbte Land und dann der erschrocken wirkende Himmel, der sich bis zum Himmelreich erstreckt, und überall am Horizont die Stümpfe und Stacheln unbekannter Bäume.”
“Noch während wir den Pfad entlangreiten, können wir sehen, wie übel Lige dran ist. Ein wunderschöner Bach, der wie ein endlos bereifter Bart verläuft. Feld um Feld besorgt aussehnenden Landes. Hohes geschwärztes Unkraut, und halb geerntete, verfaulende Nutzpflanzen. Dieses vergilbte Land und dann der erschrocken wirkende Himmel, der sich bis zum Himmelreich erstreckt, und überall am Horizont die Stümpfe und Stacheln unbekannter Bäume.”
Mit diesem Roman stand der Ire Sebastian Barry 2017 auf der Longlist für den Man Booker Prize, dem wichtigsten Literaturpreis für britische Prosa. Schon vorher hat er sich mit einem Roman über den ersten Weltkrieg und anderen über die Auseinandersetzungen im Irland des frühen 20. Jahrhunderts hervorgetan. In “Tage ohne Ende” hat er sich einer neuen Region zugewandt: dem nordamerikanischen Kontinent zur Zeit des Wilden Westens und des US-amerikanischen Bürgerkrieges.
Protagonist und Ich-Erzähler ist ein Ire, Thomas McNulty, der als Jugendlicher vor den großen Hungersnöten in die neue Welt geflüchtet ist und dort auf seinen Freund und seine große Liebe John Cole trifft. Mit ihm tanzt er zunächst, als Frauen verkleidet, im Saloon einer Bergarbeiterstadt, bevor sich beide zur Armee verpflichten und nach Westen ziehen, gegen die Indianer und bald in den Krieg…
“Wie ein irischer Simplicissimus stolpert er durch das Grauen der Feldzüge gegen die Indianer und des amerikanischen Bürgerkriegs – davon und von seiner großen Liebe erzählt er mit unerhörter Selbstverständlichkeit und berührender Offenheit.” So heißt es im Klappentext. In der Tat ist der Vergleich mit Grimmelshausens bitterbösbrachialem Roman über den 30jährigen Krieg nicht unangebracht: hier wie dort beherrscht eine rücksichtslose, unabwendbare Rohheit alle Lande, es findet sich kaum ein Schrei nach irgendeiner Form von Zivilisiertem, Überleben und Ertragen sind das tägliche Handwerk, das nicht stilisiert, sondern schlicht vorgeführt wird; die Offenheit ist zwar nicht direkt berührend, aber besticht durchaus.
Das Genre des Wild-West-Romans ist, würde ich behaupten, eng mit Groschenheften verknüpft; Barrys literarischer Ansatz leistet hier Pionierarbeit und sein Buch ist ein bemerkenswerter Versuch, in einem von Klischees und Heroismus, Mythen und Stilisierung beherrschten Themenfeld eine eigene Geschichte zu entwickeln, die realistische Maßstäbe an den Tag legt. Ihm gelingen beeindruckende Darstellungen, sein Timing für kleine Momente abseits der düsteren Grunderzählung ist tadellos.
Ich glaube dennoch nicht, dass dies ein Buch ist, das viele Leser*innen überzeugen wird. Ähnlich wie Kazuo Ishiguros großartiger Sagenroman “Der begrabene Riese” (Ishiguro hat sich sehr anerkennt zu diesem Roman von Barry geäußert), ist „Tage ohne Ende“ in seiner Komposition zu eigenwillig, um ein breites Lesepublikum für sich zu gewinnen. Er hat keine epischen Tendenzen, keine epische Grundstimmung, ist rustikal und direkt, mitunter poetisch – und viele Leser*innen werden diesen Mix für einen Mangel halten, obgleich gerade darin die Kraft seiner Darstellung liegt.
Vielleicht irre ich ja, ich hoffe es. Denn obgleich mich der Roman nicht begeistert hat (über Geschmack lässt sich nicht streiten), ist er große Literatur, eine bestechende Erzählung und ein wichtiges Dokument.
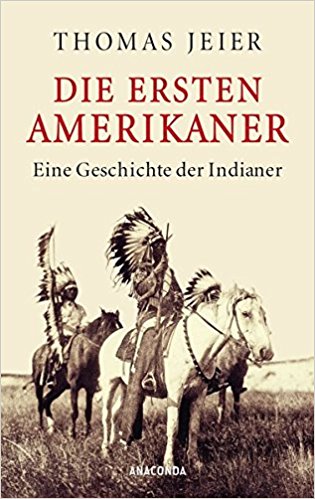 „Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“
„Es galt, in diesem Buch vor allem mit in vielen Jahrzehnten manifestierten Klischees aufzuräumen, neueste Wissenschaftserkenntnisse aufzugreifen und so dem Leser ein möglichst umfassendes Bild indianischer Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln.“